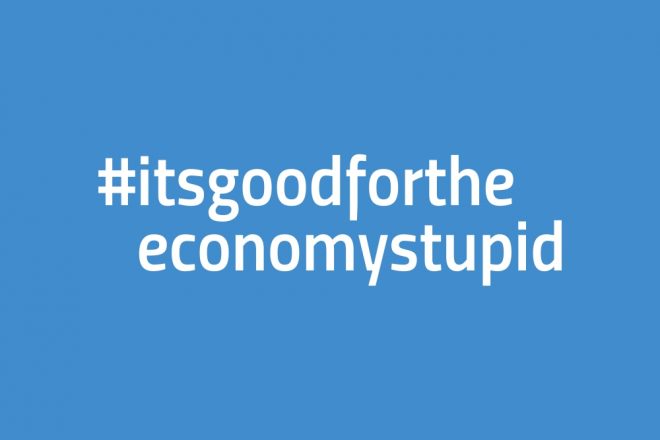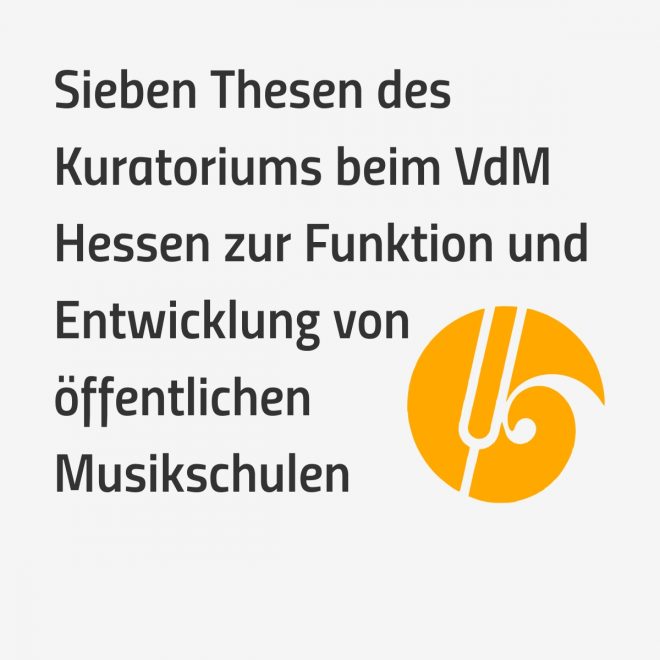Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der VdM Bundesverband startet einen Aufruf an alle VdM Landesverbände, mit ihren Mitgliedern das bislang bestehende Leitbild zu hinterfragen. Das Ergebnis soll als Arbeitsgrundlage für die Erarbeitung eines neuen Leitbildes dienen. Zugleich können wir damit die Grundlage für die Entwicklung von eigenen Leitbildern für den VdM Hessen und seine öffentlichen Musikschulen schaffen.
Wir wissen von Ihrer knappen Zeit und haben uns im VdM Hessen überlegt, den Anforderungen des VdM Bundesverbandes in der Form einer Online-Befragung genüge zu tun. Uns liegt insbesondere die Verfasstheit der VdM Musikschulen in Hessen am Herzen und wir wollen gerne zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir übermitteln dem VdM Bundesverband also die Ergebnisse Ihrer Antworten und haben gleichzeitig substanzielle Antworten für unsere Arbeit vor Ort in Hessen.
Wir wissen, auch eine Online-Befragung will mental bewältigt sein. Dennoch bitten wir Sie herzlich um Ihre Mitarbeit – für den Verbund aller VdM Musikschulen und für unsere Arbeit in Hessen. Und vielleicht können Sie aus Ihren Reflexionen der Fragen auch für Ihre Musikschule profitieren. Die Online-Befragung ist selbstverständlich DSGVO-konform. Wir übermitteln dem VdM Bundesverband ausschließlich zusammengefasste und vollständig anonymisierte Aussagen.
Bitte senden Sie uns Ihre Antworten möglichst bis zum Freitag, den 30. November 2025.
Wenn Sie mögen, dann senden wir Ihnen gerne nach Abschluss der Online-Befragung die zusammengefassten Ergebnisse, dafür müssten Sie uns Ihre E-Mail-Adresse nennen.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit, Ihre
Michael Eberhardt
Dr. Hans-Joachim Rieß
Eventuell hilfreiche Tipps für Ihr Ausfüllen
Hinweis vorab: Am Ende des Fragebogens finden Sie einen Link, um das Formular zu speichern. Sie können es zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten.
- Die wichtigste Regel für das Ausfüllen: Antworten Sie gerne spontan und „made by heart“.
- Arbeiten Sie gerne alleine oder nehmen Sie sich einen kleinen Kreis von Mitarbeiter:innen dazu.
- Wenn Ihnen auch nach längerem Nachdenken (max. drei Minuten) keine Antwort einfällt, dann liegt das entweder daran, dass die Frage doof ist, die Frage keinen Bezug zu Ihrer Musikschule hat oder die Frage schlicht irrelevant ist.
- Bitte antworten Sie frei von der Leber weg – Sie haben die Expertise vor Ort, Sie wissen um die Bedingungslagen, die Strömungen und Entwicklungstendenzen in Ihrer Region und in Ihrem Umfeld. Genau dieses Wissen und Gespür wollen wir. Bitte!
Definitionen zur Klärung
Im Fragebogen kommen Worte vor wie Vision, Mission, Werte, Kultur, Leitbild und Haltung. Entweder nehmen Sie die Begriffe so, wie Sie sie verstehen oder Sie werfen einen kurzen Blick auf unsere Erläuterungen – beides ist in Ordnung.
Die sechs Begriffe Vision, Mission, Werte, Kultur, Leitbild und Haltung gehören zur normativen Steuerung einer Organisation, unterscheiden sich jedoch in ihrer Funktion und Wirkrichtung. Ihre Beziehung zueinander lässt sich in einer logischen, sinnbildenden Reihenfolge darstellen:
1. Vision – Wozu?
Die Vision steht am Anfang. Sie ist das große, inspirierende Zukunftsbild, das beschreibt, wofür die Organisation in der Welt wirken will – jenseits des Konkreten. Die Vision ist zielbildhaft, emotional und langfristig, sie stiftet Sinn und gibt die Richtung vor. Ohne Vision ist keine strategische Orientierung möglich.
2. Mission – Warum?
Aus der Vision folgt die Mission. Sie beschreibt den Daseinszweck der Organisation im Hier und Jetzt: Was ist unser Auftrag? Wem dienen wir? Warum gibt es uns? Die Mission übersetzt das Fernziel der Vision in eine klare Selbstverpflichtung und Wirkungserwartung.
3. Werte – Nach welchen Prinzipien?
Werte setzen den normativen Rahmen für das Handeln: Welche Grundüberzeugungen leiten uns bei Entscheidungen, im Umgang miteinander und mit der Welt? Sie stützen die Mission und helfen, die Vision glaubwürdig und konsistent zu verfolgen. Werte wirken identitätsstiftend.
4. Haltung – Wie treten wir auf?
Haltung ist die Verkörperung der Werte im konkreten Verhalten. Sie zeigt sich in Entscheidungen, in der Kommunikation und in der Setzung von Prioritäten, insbesondere in Spannungsfeldern, die einer Abwägung bedürfen. Haltung ist das Rückgrat der Organisation – Haltung ist gelebte Werte in Aktion.
5. Kultur – Wie arbeiten wir zusammen?
Kultur entsteht aus gemeinsam gelebten Haltungen, Routinen und Erfahrungen. Kultur ist der soziale Aggregatzustand der Organisation: Wie gehen wir miteinander um? Wie gestalten wir Veränderung? Kultur ist nicht direkt steuerbar. Kultur ist durch Führung, Kommunikation und Struktur prägend beeinflussbar.
6. Leitbild – Wer sind wir – auf einen Blick?
Das Leitbild steht zusammenfassend und kommunizierend am Ende der normativen Kette. Es bündelt Vision, Mission, Werte, Haltung und Kultur in einem adressatenorientierten Text. Es dient der Selbstvergewisserung nach innen und der Identifikation nach außen. Das Leitbild bietet Orientierung, es schafft Klarheit und es stiftet eine erkennbare Identität.
Die Reihenfolge: Vision → Mission → Werte → Haltung → Kultur → Leitbild
Jedes Element bedingt das nächste. Jedes folgende Element ist Ausdruck, Umsetzung und Verdichtung des vorherigen Elements und schafft in seinen Bezügen eine hohe Konsistenz und Beziehungsdichte der Elemente zu- und miteinander. Wer ein konsistentes Leitbild will, braucht Klarheit in der Vision, Mission und den Werten – und muss wissen, wie diese sich konkret in der Haltung und Kultur zeigen.
Definitionen der Begriffe
Die Vision einer Organisation beschreibt ein erstrebenswertes Zukunftsbild – einen Zustand, den es noch nicht gibt, den die Organisation aber erreichen will. Die Vision formuliert ambitioniert und kraftvoll das positive Wirken der Organisation in die Welt hinein – in das direkte Umfeld, in die Region, in den Wirkungskreis der Organisation hinein und wie sich diese durch das Wirken der Organisation künftig darstellen könnten. Eine Vision gibt Richtung und langfristige Orientierung. Sie ist kein konkretes Ziel, sondern ein Kompass, der inspiriert und motiviert. Eine gut formulierte Vision schafft Identifikation, setzt Energie frei und bündelt Kräfte – intern wie extern. Sie stellt den Möglichkeitsraum dar, in dem sich Entwicklung, Innovation und Engagement entfalten können.
Die Mission einer Organisation beschreibt ihren übergeordneten Zweck und gesellschaftlichen Auftrag – also wofür die Organisation im Kern steht, welchen Beitrag sie für ihre Zielgruppen leistet und warum es sie gibt. Die Mission steht am Anfang jeder strategischen Ausrichtung und ist Teil der normativen Steuerung. Sie bildet das Fundament für Ziele, Strategien, Handlungsfelder, Maßnahmen und das Selbstverständnis der Organisation. Eine klar formulierte Mission stiftet Sinn, Orientierung und Identität – nach innen wie nach außen. Sie verdeutlicht allen Beteiligten, was Erfolg für die Organisation bedeutet, wie Wirkung entsteht und woran sich Prioritäten ausrichten.
Werte beschreiben die grundlegenden Haltungen, Überzeugungen und Prinzipien, nach denen sich das Denken und Handeln in einer Organisation richtet – bewusst oder unbewusst. Werte bilden die normative Grundlage der Organisationskultur und prägen Entscheidungsverhalten, Führungsstil und Zusammenarbeit. Sie sind eng verknüpft mit der Mission und beeinflussen die Art und Weise, wie Ziele verfolgt werden. Gemeinsam getragene Werte fördern Bindung, Vertrauen und Zusammenhalt. Sie bieten Orientierung in komplexen und unklaren Situationen und schaffen eine emotionale Verbindung zur Organisation. Sie stärken die Identifikation der Mitarbeiter:innen mit ihrer Aufgabe.
Die Haltung einer Organisation beschreibt die innere Grundhaltung, mit der Menschen ihrer Aufgabe nachgehen. Sie zeigt sich in Sprache, Verhalten und Entscheidungen – gerade in herausfordernden Situationen. Haltung verbindet Überzeugung mit Verantwortung. Haltung ist Ausdruck von Reife, Souveränität und Prinzipientreue. Eine klare Haltung schafft Vertrauen – nach innen wie nach außen. Sie ermöglicht Klarheit in der Kommunikation, Konsistenz im Handeln und Glaubwürdigkeit in der Wirkung. Haltung ist nicht beliebig. Sie ist das Rückgrat einer Organisation, die ihre Werte lebt und ihren Auftrag ernst nimmt.
Die Kultur einer Organisation beschreibt die gelebte Praxis im Miteinander – wie Menschen miteinander arbeiten, kommunizieren, entscheiden, Konflikte lösen und Veränderungen gestalten. Sie zeigt sich in Routinen, Erwartungen und unausgesprochenen Regeln. Kultur ist Teil der informellen Steuerung einer Organisation. Sie wirkt zwischen den formalen Strukturen und beeinflusst maßgeblich die Umsetzung von Strategien und Veränderungsvorhaben. Eine förderliche Kultur ermöglicht Vertrauen, Zusammenarbeit, Lernbereitschaft und Anpassungsfähigkeit. Sie entscheidet oft über den Erfolg oder Misserfolg von Veränderungsprozessen.
Das Leitbild einer Organisation bringt Mission, Vision, Werte und strategische Grundsätze in eine stimmige Gesamtaussage. Es beschreibt, wer die Organisation ist, wofür sie steht, wie sie wirkt und wie sie arbeiten will. Als kommunikatives Dach bietet es Orientierung für Mitarbeiter:innen, Führungskräfte, Partner und die Öffentlichkeit. Ein gutes Leitbild ist verbindlich und motivierend zugleich. Es übersetzt normative Prinzipien in den konkreten Kontext der Organisation. Es wirkt identitätsstiftend, stärkt das Selbstverständnis und dient als Referenzrahmen für Entscheidungen, Kommunikation und Weiterentwicklung.
Die Intention des Fragebogens
1. Der Fragebogen richtet sich auf die Gegenwart. Wir wollen den Sachstand rund um Ihre Lebenswirklichkeit vor Ort wissen und inwieweit Ihr Leitbild in Bezug zu dieser steht.
2. Der Fragebogen richtet sich an die Zukunft. Wir wollen die zukünftigen Anforderungen der auf sie zukommenden Lebenswirklichkeit vor Ort wissen und inwieweit Ihr Leitbild in Bezug zu dieser stehen könnte und sollte.
3. Wir wollen die von Ihnen wahrgenommenen Lücken im Abgleich von Gegenwart und möglicher Zukunft wissen und inwieweit hierbei ein neues Leitbild eine unterstützende Kraft entfalten könnte.
4. Wir wollen den aus Ihrer Sicht erforderlichen Handlungsbedarf wissen, um die Zukunft gut zu gestalten und inwieweit hierbei ein neues Leitbild eine klare Orientierung geben und wirksame Leitplanken bieten kann.
Quellen, die Sie für Ihre Arbeit hinzuziehen können
• Grundsatzprogramm des VdM Bundesverbandes
• Leitbild des VdM Bundesverbandes
• Leitbild der öffentlichen Musikschulen im VdM
• Leitfragen Grundsatzprogramm und Leitbild – VdM 2025 (aus diesen Leitfragen entwickelten wir den Fragebogen)
Der Aufbau des Fragebogens
Der Fragebogen besteht aus geschlossenen, skalierten und offenen Fragen, um Ihnen die Arbeit so leicht wie möglich zu machen, für Antworten mit Substanz und um Ihre Freude am Ausfüllen zu begünstigen. Und jetzt geht es los.